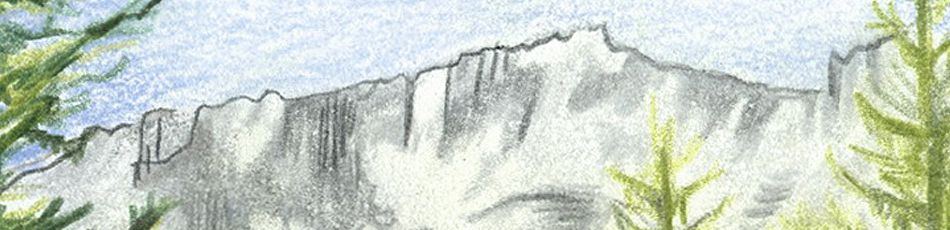Einen Schutzwald zu pflegen ist eine komplexe Aufgabe

Interview mit Alfons Rauch
Alfons Rauch ist Revierleiter am Forstbetrieb Schliersee und koordiniert seit über 30 Jahren die Schutzwaldmaßnahmen im Sanierungsgebiet Hagenberg.
Seit über drei Jahrzehnten gibt es das Sanierungsgebiet Hagenberg. Wie viele Bäume wurden seitdem gepflanzt?
Früher waren es bis zu 10 000 Pflanzen im Jahr, heute sind weniger nötig, weil es einen echten Fortschritt in der technischen Lawinenverbauung gibt.
Wieso profitiert der Forstwirt von modernen Verbauungsmethoden?
Einen Schutzwald zu pflegen ist eine komplexe Aufgabe. Wir kümmern uns um junge Pflanzen – und um die Infrastruktur, die dafür sorgt, dass die Bäume nicht beim nächsten Starkregen oder Lawinenabgang den Bach beziehungswiese die Lawinenbahn runtergehen. Die Topographie am Hagenberg ist prädestiniert für Abgänge. Im Lawinenkataster sind 15 bis 20 größere und kleinere Rinnen verzeichnet – mit Kahlflächen samt Humusschwund und schlechten Möglichkeiten für den Baumnachwuchs. Mit anderen Worten: Sind die Bäume einmal weg, hat es der Wald schwer. Da hilft es nicht, bloß neue Bäume zu pflanzen.
Können Sie Fortschritte feststellen?
Natürlich. Das Projekt begann vor über 30 Jahren, als Forscher anhand von Luftbildvergleichen festgestellt haben, dass sich in nur 20 Jahren der Bergwald am Hagenberg um ein Fünftel reduziert hatte. Direkt oberhalb der Spitzingstraße. Allein aus Objektschutzcharakter mussten wir reagieren. Diese Entwicklung konnten wir stoppen. Dort, wo wieder Schutzwald entstanden ist, hat es keine nennenswerten Lawinenabgänge mehr gegeben.
Welche Bäume pflanzen Sie?
Fichten, Tannen, Buchen, auch Lärchen als Pionierbaumarten. Gerade in sensiblen Arealen müssen wir auf eine gesunde Mischung achten, die Wälder dürfen nicht anfällig sein. Wild, Pilze, Insekten oder Trockenheit können unsere Arbeit schnell zunichte machen. So haben wir relativ wenig Ausfälle, auch wenn der Berg eine Neigung von 35 Grad hat, viele Abschnitte fast senkrecht sind und einige Stellen schon nahe der Baumgrenze liegen. Kletterausrüstung gehört da zum Arbeitsgerät. Da ist man als Waldarbeiter froh, wenn man wieder heil rauskommt.
Also ist Ihr Tun keine mühsame Form moderner Sisyphosarbeit?
Keineswegs. Die Ergebnisse sind durchaus beeindruckend, man braucht nur einen langen Atem. Die Vegetationsperioden im Hochgebirge sind kurz, unsere Arbeitsphasen auch. Wir können erst im Mai beginnen, im Oktober mit der ersten Reifbildung wird es zu gefährlich für die Arbeiter. Es dauert, bis ein Schutzwald wächst. Aber an vielen Stellen wächst wieder mannshoher Wald.
Würde die Natur den Schutzwald auf lange Sicht nicht selber richten?
Nein, das ist eine Wunschvorstellung. Der Wald würde sich nur an optimal geschützten Stellen auf sehr, sehr lange Sicht erholen. Und das auch nur, wenn man den Wildbestand und damit den Verbiss gezielt regulieren würde. Wenn wir nicht eingreifen würden, hätte das nur eine Konsequenz: Dass wir uns an den bedrohlichsten Stellen vom Wald verabschieden. Straßen würden regelmäßig verschüttet, Siedlungen wären bedroht und der Alpentourismus hätte ein ernsthaftes Problem.
Gibt es keine Alternativen?
Beton, Stahl und großflächige bauliche Eingriffe, mit denen man nichts für den Wald tut. Über großflächige Lawinengalerien an den Straßen könnten Lawinen rauschen – vorausgesetzt es gibt keine Siedlungen weiter unten im Tal. Wie am Schliersee.